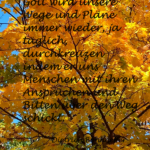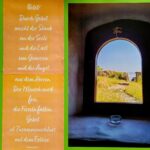Autoren-Archiv: LKG
Gedanken zum Monatsspruch August
Du bist mein Helfer, und unter dem Schatten
deiner Flügel frohlocke ich.
Psalm 63, 8
Hat Gott Flügel? Im obigen Psalmengebet wird von den Flügeln Gottes gesprochen. Gott
wird hier mit einem Vogel verglichen, der seine Küken schützend unter seine Flügel nimmt.
Dieses Bild beschreibt, wie Gott sich als Helfer zeigt: In seiner Nähe dürfen wir uns sicher
fühlen, wie die kleinen Vögel unter den Flügeln ihrer Elternvögel.
Was mich so fasziniert, ist die Leichtigkeit und Freude, die sich dabei einstellt. Wenn ein
Vogel bedroht wird und Angst hat und sich „unter die Flügel“ begibt, dann stelle ich mir
vor, dass das Tier ganz still ist und vorsichtig abwartet, bis die Gefahr vorbeigeht. Das Bild
spricht aber davon, dass die Küken hier fröhlich singen. Sie sind völlig ohne Angst. Sie
fühlen sich sehr sicher, sodass sie sogar „frohlocken“ können.
Was tun, wenn es schwierig wird? Wenn das Leben oder der Alltag mich überfordert? Wenn
sich die ein oder andere Angst einstellt und ich mich unsicher fühle? Wie kann Gott da zu
meinem Helfer werden? In der Nähe Gottes kann ich sicher sein. In der Nähe Gottes?
Manchmal, gerade in schwierigen Situationen scheint Gott sehr weit entfernt zu sein. Dann
fehlt das Gefühl von Schutz und Sicherheit.
Die kleinen Küken suchen die Nähe ihrer großen Elternvögel. Sie laufen ihnen nach. Sie
schlüpfen unter ihr Gefieder. Wie kann ich Gottes Nähe suchen, wenn er mir gerade fern
erscheint? Ich erinnere mich dann gerne an einen Satz, der mich seit vielen Jahren
begleitet: „Gott ist nur ein Gebet weit entfernt“.
Im Gebet kann ich mich an Gott wenden und ihm nahekommen. Hier kann ich meine Ängste
und meine Überforderungen ausdrücken. Alles, was mich belastet, kann ich Gott sagen.
Hier ist auch Raum für Klage, Zweifel und Verzweiflung, für Ärger, Wut und Hilflosigkeit. Das
ist für uns etwas gewöhnungsbedürftig, aber viele Psalmengebete beginnen mit Klagen
und Fragen an Gott. In Zeiten, in denen Gott nicht nahe erscheint, nahen sich ihm die
Betenden, indem sie Gott fragen, warum er nicht eingreift. Viele dieser Gebete enden dann
mit Dank und dem Versprechen, Gottes Wohltaten zu verkündigen. Wir wissen allerdings
nicht, wie viel Zeit zwischen Klage und Dank liegt: Stunden, Tage, Wochen, Monate oder
mehr?
Im Gebet dürfen wir uns Gott nahen. Er nimmt uns auch mit unseren Ängsten und unserer
Hilflosigkeit unter seine Fittiche. Und wenn ich alles, was mich belastet, bei Gott im Gebet
abladen kann, dann stellt sich möglicherweise auch eine Leichtigkeit ein. Ein Gefühl von
Schutz und Geborgenheit, ein Vertrauen, dass es gut ist oder wird, auch wenn es sich
gerade nicht danach anfühlt und eine Dankbarkeit, dass Gott mein Helfer ist.
Möglicherweise endet ein solches Gebet mit Freude.
Von meinem Spaziergang habe ich mir heute eine Feder mitgenommen. Sie soll mich daran
erinnern, dass ich sicher und geborgen bin.
Prof. Dr. Andrea Klimt (Theologische Hochschule Elstal)
Gedanken zum Monatsspruch Juli 2023
Jesus Christus spricht: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Mt. 5, 44-45
Diese kurze Andacht wird nicht die Frage beantworten, wie der Krieg in der Ukraine zu einem Ende kommen und wieder Frieden werden kann. Ich werde dir, liebe Leserin und lieber Leser, auch nicht sagen, was du angesichts von Unfrieden und Gewalt zu tun und zu lassen hast. Und ich werde dich nicht mit lebenspraktischen Beispielen aus deinem Alltag abholen. Heute geht vielmehr darum, dass du ein Wort Jesu in deinen Alltag hineinlässt. Nimm dir zehn Minuten Zeit, nimm eine Bibel zur Hand und lies die Textstellen, von denen hier die Rede ist, lies vielleicht auch ein paar Verse davor und danach. Wir nähern uns dem Monatsspruch auf einem kleinen Umweg. Rabbi Hillel der Alte, der der Überlieferung nach eine Generation vor Jesus lebte, lehrte: „Sei von den Jüngern Aarons, Frieden liebend und dem Frieden nachjagend.“ Dass Aaron, der Ahnherr des Priesteradels, Jünger oder Schüler hatte, steht gar nicht in der Bibel, und es gibt eigentlich auch keine biblische Geschichte, in der er als Friedensstifter auftritt. Hillel will, so scheint mir, vielmehr sagen: Es kommt nicht darauf an, von vornehmer Abstammung zu sein, sondern: wer friedfertig ist, der ist von wahrhaft edler Art, so edel wie Aaron. In Hillels Ausspruch steckt ferner eine Anspielung auf Ps. 34,15: „Suche Frieden und jage ihm nach.“ Das Psalmwort wird auch im Neuen Testament zweimal zitiert, nämlich im Hebräerbrief (12,14) und im Ersten Petrusbrief (3,11). Auffällig ist, dass der Friede hier als etwas Flüchtiges beschrieben wird, das zu entwischen droht, wenn man ihm nicht aktiv hinterherläuft. Ähnliche Gedankengänge finden sich in der Bergpredigt Jesu. In den Seligpreisungen heißt es (Mt 5,9): „Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.“ Wieder geht es darum, dass Friede etwas ist, das aktives Handeln erfordert, das nicht durch passives Aussitzen erreicht wird. „Söhne Gottes“ ist noch weitaus kühner als die Formulierung „Jünger Aarons“, die Hillel gebraucht hatte. Von wem aber werden die Friedensstifter „Söhne Gottes“ genannt werden? Anscheinend von Gott selbst, denn Jesus verwendet nach der Sitte seiner Zeit häufig das Passiv, wenn er von Gott als dem Handelnden spricht. Warum aber „Söhne“ und nicht auch „Töchter“? Auch die Frauen sind gemeint. Wieder ist es die Ausdrucksweise der Zeit. Damals sprach man von einer Gruppe von Menschen, zu der sowohl Frauen als auch Männer gehören, im Maskulinum Plural, und so haben wir es ja auch im Deutschen bislang meist getan. Die Lutherbibel 2017 will es besser machen und übersetzt inklusiv „Kinder Gottes“. Aber das könnte zu falschen Assoziationen führen. Es gibt fromme Erwachsene, die meinen, als Christin oder Christ dürfe oder solle man wieder so einfältig werden wie ein kleines Kind. Das wäre manchmal ja auch ganz bequem, denn ein Kind trägt keine Verantwortung für sein Handeln. Das ist aber im Text nicht gemeint. Es geht hier nicht um kleine Kinder, sondern um erwachsene Söhne und Töchter. „Söhne“ ist so zu verstehen, dass diejenigen, die Frieden tun, mit ihrem Handeln dem Wesen, der Art Gottes entsprechen, dass sie Anteil an Gott haben. Entsprechend redet unser Herr von „Söhnen des Königreichs“ (Mt 8,12), „Söhnen der Auferstehung“ (Mt 20,36), „Söhnen des Friedens“ (Lk 10,6) und „Söhnen des Lichts“ (Lk 16,8). Es geht bei dieser Redeweise also nicht um eine emotional aufgeladene Vater-Kind-Beziehung, sondern um Anteil an, oder Entsprechung mit, einer Eigenschaft oder Wesensart. Das Friedenshandeln, zu dem Jesus seine Schülerinnen und Schüler anleitet, hat seine Begründung im Wesen Gottes und nicht in der strategischen Aussicht auf Erfolg. Dieser mag sich zwar zuweilen einstellen, etwa in einfachen Alltagskonflikten, wenn wir boshaftes Verhalten nicht mit gleicher Münze heimzahlen und dadurch unser Gegenüber entwaffnen. Aber in dem Abschnitt, in dem unser Monatsspruch steht, werden Situationen geschildert, die schon aus dem Ruder laufen: Da erleidet jemand grobes Unrecht und will immer noch den Frieden, lässt sich nicht verleiten zu Hass und Rache, obwohl das nach menschlichen Maßstäben völlig gerechtfertigt wäre. Wie gesagt, es gibt wohl keine einfache Antwort auf die Frage, wie wieder Friede werden kann angesichts der gegenwärtigen militärischen Konflikte. Für heute mag es genügen, dass wir mit der Sehnsucht nach einem Leben gemäß dem Wesen Gottes in den Alltag gehen, denn „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“ (1Joh 4,16).
Martin Rothkegel (Theologische Hochschule Elstal)
Gedanken zum Monatsspruch Juni 2023
Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom
Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle.
1. Mose 27, 28
„Bist Du glücklich?“ Wann hat Ihnen jemand das letzte Mal diese
Frage gestellt? Ich meine nicht die eher beiläufige, häufig floskelhafte
Frage „wie geht’s?“, sondern die unvoreingenommene, ganz offene,
ehrliche und interessierte Frage nach Ihrem persönlichen
Wohlergehen. Würden Sie von sich sagen, dass Sie glücklich sind?
Finden Sie diese Frage eher leicht oder schwer zu beantworten? Falls
Sie zögern – an welcher Stelle spüren Sie den inneren Widerstand?
Was gehört für Sie unbedingt dazu, um sagen zu können: „Ja, ich bin
glücklich!?“
Ich vermute, die Frage nach dem Glück war im alten Israel auch keine
alltägliche. Die Bibel schildert, wie in besonderen Lebenssituationen
Menschen einander den Segen Gottes zugesprochen haben. Dann
war man nicht geizig mit Wünschen, sondern hat quasi alle Register
gezogen. Das zeigt der aktuelle Monatsspruch, ein Ausschnitt aus
dem Gespräch zwischen Jakob und seinem Vater Isaak. Isaak segnet
seinen Sohn (den er an dieser Stelle noch für den erstgeborenen
Esau hält) mit dem Besten, was man sich zu damaliger Zeit nur
vorstellen konnte: mit dem „Tau“ des Himmels – obwohl Regen selten
verlässlich fiel –, dem „Fett“ der Erde – auch wenn der Acker meist
nur mühsam seinen Ertrag lieferte –, mit „Korn und Wein“ die Fülle –
obwohl der Hunger ein ständiger Begleiter war. Gewünscht wird kein
Durchschnitt, kein „Mehr-oder-weniger-gut-durchkommen“, sondern
die ganze Lebensfülle. Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen so viel
Gutes wünschen würde?
Ich wünsche Ihnen das Beste!
Prof. Dr. Dirk Sager